Biologische Produktion für die Medizin
Ob im Kampf gegen Malaria oder Krebs – die Medizin nutzt bereits erste Erkenntnisse aus der Synthetischen Biologie.
Instrumente der Synthetischen Biologie wie das Programmieren von Zellen liefern eine wichtige Basis dafür, dass Medikamente oder Impfstoffe effizienter hergestellt und neue Arzneimittelkandidaten leichter identifiziert werden können. In den vergangenen 30 Jahren hat sich in der Medikamentenherstellung ein tiefgreifender Wandel vollzogen – neben chemischen Verfahren greifen immer mehr Arzneimittelfirmen auf biotechnologische Methoden zurück. So werden schon heute mehr als 200 Medikamente, die in Deutschland zugelassen sind, mithilfe biologischer Mini-Fabriken hergestellt. Bei diesen Medikamenten handelt es sich um aktive Biomoleküle wie Hormone oder Antikörper, die sich in ihrer dreidimensionalen Form nur von lebenden Organismen oder Zellen produzieren lassen. Diese werden in riesigen Stahlkesseln, den Fermentern, gezüchtet und vermehrt, sodass sie das gewünschte therapeutisch wirksame Biomolekül in großen Mengen herstellen.
Mit effizienter Biofabrik zum Malariamittel
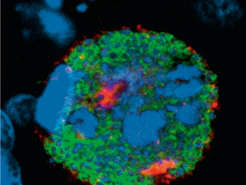
Forscher der Synthetischen Biologie setzen bei den Entwicklungen der modernen Biotechnologie an. Mithilfe der dort genutzten Methoden können sie heute immer komplexere Biosynthesewege entwerfen. So sind sie inzwischen in der Lage, zahlreiche Gene gleichzeitig in Organismen, die für die industrielle Produktion optimiert sind, einzuschleusen und damit mehrstufige, molekulare Produktionsstraßen in Gang zu setzen (zu Zellen programmieren). Auf diese Weise haben Bioingenieure zum Beispiel den Herstellungsprozess des Anti-Malaria-Wirkstoffs Artemisinin extrem vereinfacht. Das komplexe Molekül Artemisinin ist ein effektiver Killer – kein anderer Naturstoff macht den Erregern der Tropenkrankheit Malaria im Blut von Patienten besser den Garaus. Der Bedarf an Medikamenten ist hoch, doch die Gewinnung schwierig.
Bis dato musste die Substanz sehr aufwendig aus dem Einjährigen Beifuß, einer krautigen Pflanze, extrahiert werden. Im Jahr 2004 hatte die Organisation OneWorld Health – heute ein Arm der gemeinnützigen Gesellschaft PATH – das Malaria-Projekt gestartet und dafür eine Millionenförderung durch die Bill & Melinda Gates Stiftung erhalten. Das Ziel: Die Verfügbarkeit des Wirkstoffs gewährleisten und die Preise stabilisieren. Mit dabei waren auch die Forscher um Jay Keasling von der University of California in Berkeley (USA) und das kalifornische Biotechnologie-Unternehmen Amyris.
Zusammen konstruierten sie zunächst im Bakterium Escherichia coli und später dann auch in Bäckerhefen den kompletten Biosyntheseweg aus einem Ensemble von einem Dutzend Genen aus Beifußpflanzen, Bakterien und Hefen. Die Mikroben wurden durch dieses Metabolic Engineering zu zellulären Fabriken für Artemisininsäure umprogrammiert. Dieses Molekül ist eine Vorstufe, aus der sich mit einem photochemischen Schritt schließlich Artemisinin herstellen lässt. Im Laufe der Zeit haben die Forscher die Ausbeute an Artemisininsäure von ursprünglich 1,6 Gramm auf 25 Gramm pro Liter gesteigert (Paddon; Nature 2013). 2008 stieg der französische Pharmakonzern Sanofi bei dem Malariaprojekt ein, erwarb die Nutzungsrechte für die Hefestämme und optimierte die industrielle Produktion. Seit 2012 läuft die Produktion von Artemisininsäure in Bulgarien und die photochemische Synthese in Italien. Seit 2014 ist das halbsynthetische Malariamittel auf dem Markt.
Pflanzenzellen produzieren Krebswirkstoff
Auch beim Wirkstoff Paclitaxel – die Basis des Chemotherapeutikums Taxol – arbeiten Bioingenieure an vereinfachten Herstellungsverfahren. Der komplette natürliche Biosynthese-Weg für Paclitaxel umfasst 19 Schritte. Eine Paclitaxel-Vorstufe kann aus Extrakten der Europäischen Eibe gewonnen werden; die Vorläufer-Substanz wird anschließend chemisch modifiziert. Um den Einsatz der natürlichen Ressourcen zu reduzieren, haben Bob Finn und seine Mitarbeiter an der Cornell University in New York (USA) in den 1990er-Jahren ein Alternativverfahren entwickelt: Die Studenten Chris Prince und Bobby Bringi hatten Eibenzellen gentechnisch so optimiert, dass sie Paclitaxel im Fermenter herstellen können, für die Produktion also keine Eibengewächse mehr benötigt werden.
Darauf aufbauend gründeten sie die Firma Phyton Biotech, um daraus ein industriell nutzbares Verfahren zu entwickeln. Heute ist das Unternehmen als eines der wenigen weltweit auf die Produktion von Arzneien in Pflanzenzellen spezialisiert. Seit 1993 betreibt es eine Anlage zur Fermentation von Pflanzenzellen in Ahrensburg (Schleswig-Holstein). Seit 2002 produziert das Unternehmen hier Taxol im Auftrag des US-Pharmaunternehmens Bristol-Myers Squibb.
Seit einigen Jahren versuchen Forscher nun mit Methoden der Synthetischen Biologie, die Herstellung von Paclitaxel auch in Bakterien oder Hefen, die in der biotechnologischen Produktion etabliert sind, zu ermöglichen. So ließe sich das Medikament noch kostengünstiger und schneller produzieren als in dem Prozess auf Basis von Pflanzenzellen.
Eine Herausforderung stellt jedoch der 19stufige Syntheseweg dar: Da er noch nicht komplett verstanden ist, müssen sich die Forscher der Synthetischen Biologie schrittweise vorarbeiten. Inzwischen ist es bereits gelungen, einige Synthesewege so nachzubauen, dass die Produktion von ersten Vorstufen des Wirkstoffs möglich ist. (Ajikumar Science 2010; Engels; Metabolic Engineering 2008)
Grippeimpfstoffe schneller herstellen
Mit Methoden der Synthetischen Biologie wird nicht nur die Herstellung von Medikamenten verbessert. Bioingenieure haben sich inzwischen auch daran gemacht, die Produktion von Grippeimpfstoffen zu beschleunigen. Bislang erfordert die Herstellung saisonaler Grippe-Impfstoffe ein mehrstufiges Vorgehen, das mehrere Monate in Anspruch nimmt: Zunächst müssen Virenproben grassierender Erreger genommen werden, auf deren Basis zunächst sogenannte Saatviren gewonnen werden. Bei diesen Saatviren handelt es sich um vermehrungsfähige Viren, mit denen die Impfstoffhersteller in Hühnereiern oder Zellen dann schließlich den aktuell benötigten Impfstoff in großen Mengen produzieren.
Mit den Werkzeugen und Instrumenten der Synthetischen Biologie haben Forscher des Schweizer Pharmakonzerns Novartis und vom US-amerikanischen J. Craig Venter Institute im Jahr 2013 Saatviren in einer statt wie bisher in fünf Wochen erzeugt. Dazu synthetisierten sie – ausgehend von Sequenzen aktueller Erreger sowie allgemeiner typischer Grippevirengene – DNA im Labor und bauten daraus ein funktionstüchtiges hybrides Virusgenom zusammen (zu DNA und Genome herstellen). Auf diese Weise entfallen zahlreiche der bisher nötigen Laborschritte. Zudem kann so schneller überprüft werden, ob die Erbinformation korrekt gefertigt wurde. Beim H7N9-Ausbruch in China wurde dieses Vorgehen erstmals erprobt. (Dormitzer, Science Translational Medicine 2013)
Auf dem Weg zu einer neuen Generation von Grippeimpfstoffen experimentieren die Bioingenieure bei Novartis auch mit sogenannten synthetischen RNA-Impfstoffen. Dazu erzeugen sie im Labor chemisch RNA-Moleküle. Die RNA-Moleküle enthalten lediglich den Bauplan für die Grippevirusproteine, die für die Immunisierung besonders relevant sind. Verabreicht man diese RNA-Impfstoffe einem Probanden, so beginnt dessen Körper mit der Produktion der passenden Erreger-Proteine und trainiert auf diese Weise die eigene Immunabwehr (Geall, PNAS 2012). Nach Ansicht der Forscher ließe sich damit eine ähnliche Wirkung wie mit ‚normalen’ Impfstoffen erzielen. Noch befindet sich ihre Forschung jedoch in einer frühen Phase und hier sind weitere Tests zu dem Ansatz nötig. Wenn die Forscher erfolgreich sind, wäre dies ein Durchbruch für Grippeimpfstoffhersteller: RNA-basierte Impfstoffe lassen sich wesentlich einfacher und schneller produzieren als eiweißbasierte Impfstoffe – der zeitaufwendige Saatviren-Zwischenschritt und die anschließende Produktion in Hühnereiern oder Zellkulturen würde entfallen.
Genetische Module und Schaltkreise mit Potenzial
Methoden der Synthetischen Biologie können es auch erleichtern, neue pharmakologische Wirkstoffe aufzuspüren. Forscher um Eriko Takano von der Universität Groningen in den Niederlanden fahnden im Erbgut von Mikroorganismen nach genetischen Modulen, die die Einzeller nicht mehr nutzen, die aber in der Lage sind, bisher unbekannte Antibiotika zu produzieren. Die Baupläne für die Antibiotika sollen dann künstlich nachgebaut und in synthetischen genetischen Regelkreisen integriert werden, um die Information auf den stillgelegten genetischen Modulen zu Antibiotikaherstellung nutzen.
Darüber hinaus gibt es Forschungsansätze in der Synthetischen Biologie, diagnostische Sensoren, die etwa einen Mangel im Körper registrieren und die Wirkstoffproduktion in neuartigen Implantaten zusammenführen. Diese genetischen Netzwerke sind so konstruiert, dass sie auf ein Signal reagieren und eine hormonaktive Substanz produzieren. So haben Forscher um Martin Fussenegger der ETH Zürich im Sommer 2014 beispielsweise eine molekulare, implantierbare Prothese zur Behandlung von Diabetes vorgestellt (Ausländer, Molecular Cell, 2014). Dabei handelt es sich um Designer-Zellen mit einem Biosensor, der konstant den Säuregrad des Blutes misst, und einem genetischen Regelkreis, der die benötigte Menge an Insulin produziert.
In diesem Fall haben es die Forscher also geschafft, den Regelkreis so zu konstruieren, dass das Signal im Körper selbst entsteht, es vom Sensor wahrgenommen wird und dieser wiederum eine fein abgestimmte therapeutische Gegenreaktion auslöst. Millionen dieser maßgeschneiderten Designer-Zellen betteten die Forscher wiederum in Kapseln ein, welche als Implantat in den Körper eingesetzt werden könnten. Bislang haben die Forscher ihr System an Mäusen getestet, langfristig könnte damit ein neuer Ansatz zur Behandlung von Diabetes-Patienten etabliert werden.
Um die Funktionsfähigkeit des Sensors zu testen, setzten die Forscher auch auf die Hilfe von mikrofluidischen Plattformen. Damit haben sie ihren diagnostischen Test vor den Tierversuchen im Mikromaßstab unter Laborbedingungen überprüft. Die Dynamik der Insulinproduktion modellierten sie zudem vorab im Computer, um die Zellen für eine möglichst effektive Herstellung des Wirkstoffs zu optimieren. Solche systembiologischen Vorgehensweisen sind aus Sicht der Forscher eine wichtige Hilfe, um die Feinabstimmung von metabolischen Prozessen in einem genetischen Regelkreis zu realisieren (zu Zellen Programmieren).
